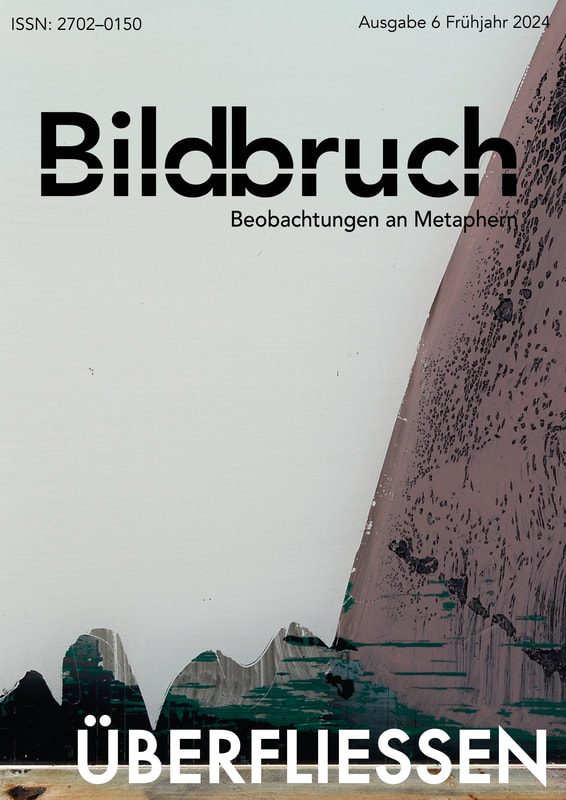|
Literatur hat ein Sensorium für das Überfließen. Dieses Sensorium bezieht sich auf die metaphorische Dimension, die mit dem Überfließen als einem der erfolgreichsten Bildfelder der Metapherngeschichte zur Disposition steht. Dabei macht die Literatur qua Anschaulichkeit auf die Interaktion zwischen thematischen Elementen und übertragenen Bedeutungen aufmerksam. Aktiviert wird das Sensorium für das Überfließen insbesondere dann, wenn Ordnungsmodelle auf dem Spiel stehen, die in verschiedenen mit dem Überfließen spezifizierten Transgressionen reflektiert werden. Das Heft versammelt Beiträge, die sich historisch übergreifend mit dem Überfließen als poetologischer Metapher beschäftigen und die metaphorischen Interaktionen in ihren Analysen ernst nehmen. Gerade im Prozessualen des Überfließens, das die analysierten Texte in ihren Bildern, Szenen und Narrativen ausstellen, zeigt sich seine Produktivität.
|

Alle Inhalte von Bildbruch erscheinen unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.